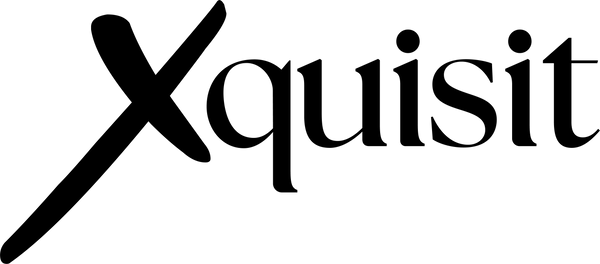Was ist eigentlich Slow Fashion?
Share
🧵 Slow Fashion: Ein bewusster Gegenentwurf zur schnellen Mode
Die Modeindustrie steht seit Jahren unter Druck. Immer kürzere Produktionszyklen, ständig wechselnde Trends und ein enormer Ressourcenverbrauch prägen das Bild der sogenannten Fast Fashion. Inmitten dieser Dynamik entsteht eine Bewegung, die entschleunigt: Slow Fashion.
Slow Fashion bedeutet, Kleidung mit Bedacht zu entwerfen und herzustellen. Es geht um Qualität statt Quantität, um Langlebigkeit statt Wegwerfmentalität. Marken, die sich diesem Ansatz verschreiben, setzen auf transparente Lieferketten, faire Arbeitsbedingungen und Materialien, die Umwelt und Haut schonen.
Auch in unserer Produktion orientieren wir uns an diesen Prinzipien. Entworfen wird mit dem Ziel, zeitlose Stücke zu schaffen – Kleidung, die nicht nach einer Saison ausgedient hat, sondern über Jahre hinweg getragen werden kann. Die verwendeten Stoffe stammen aus verantwortungsvollen Quellen, gefertigt wird in kleinen Serien, oft lokal und mit direktem Bezug zu den Menschen, die hinter jedem Kleidungsstück stehen.
Slow Fashion ist kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt – hin zu einer Mode, die wieder Bedeutung bekommt. Sie lädt dazu ein, den eigenen Konsum zu hinterfragen und Kleidung als Ausdruck von Haltung zu verstehen.
Denn Mode kann mehr sein als Trend. Sie kann Verantwortung tragen. Aber was ist eigentlich Slow Fashion? Und welche negativen Auswirkungen sind mit Fast Fashion verbunden?

🧵 Merkmale von Slow Fashion
· Langlebige Materialien Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Stoffen, die lange halten und nicht nach wenigen Waschgängen ausleiern oder verblassen.
· Zeitloses Design Keine schnelllebigen Trends, sondern klassische Schnitte und Farben, die über Jahre tragbar bleiben.
· Kleine Produktionsmengen Statt Massenproduktion wird in limitierten Stückzahlen gefertigt – oft auf Bestellung oder in kleinen Serien.
· Faire Arbeitsbedingungen Produktion erfolgt unter menschenwürdigen Bedingungen, mit fairer Bezahlung und sicheren Arbeitsplätzen.
· Transparente Lieferketten Offenlegung, wo und wie produziert wird – vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück.
· Lokale oder regionale Fertigung Herstellung möglichst nahe am Verkaufsort, um Transportwege zu minimieren und lokale Handwerksbetriebe zu stärken.
· Reparaturfreundlichkeit Kleidung wird so gestaltet, dass sie leicht repariert oder angepasst werden kann – z. B. durch Ersatzknöpfe, robuste Nähte oder einfache Schnitte.
· Verzicht auf Überproduktion Keine Lagerhaltung von überschüssiger Ware, sondern bedarfsgerechte Planung und Produktion.
· Umweltfreundliche Materialien und Prozesse Einsatz von Bio-Baumwolle, recycelten Stoffen, pflanzengefärbten Textilien oder ressourcenschonenden Verfahren.
· Bewusste Kommunikation Keine aggressive Werbung oder künstliche Verknappung, sondern ehrliche Information über Produkt und Herstellung.
· Entschleunigte Produktion Herstellung erfolgt in einem realistischen, menschlichen Tempo – ohne Zeitdruck, Akkordarbeit oder extreme Beschleunigung. Das erlaubt Sorgfalt, Qualität und Rücksicht auf die Menschen hinter dem Produkt.
🌍 Die schlimmsten Umweltprobleme durch Fast Fashion
· Extremer Wasserverbrauch Die Branche verbraucht jährlich rund 79 Milliarden Kubikmeter Wasser.
· Wasserverschmutzung durch Färbung und Chemikalien Etwa 20 % der weltweiten industriellen Wasserverschmutzung stammt aus der Textilfärbung und -behandlung. In manchen Produktionsländern ist die Modefarbe der Saison buchstäblich in den Flüssen sichtbar.
· Hoher CO₂-Ausstoss Fast Fashion verursacht über 10 % der globalen CO₂-Emissionen – mehr als internationale Flüge und Schifffahrt zusammen.
· Mikroplastik in den Ozeanen Beim Waschen synthetischer Kleidung (z. B. Polyester) gelangen jährlich rund 500.000 Tonnen Mikroplastik ins Meer.
· Textilmüll und Überproduktion Jährlich entstehen rund 92 Millionen Tonnen Textilabfälle. Weniger als 15 % der weggeworfenen Kleidung wird recycelt.
· Rohstoffverschwendung Für die Herstellung synthetischer Fasern werden jährlich fast 100 Millionen Tonnen Erdöl benötigt.
(Zahlenquellen: Sigma Earth und SRF-Fernsehen über Fast Fashion)